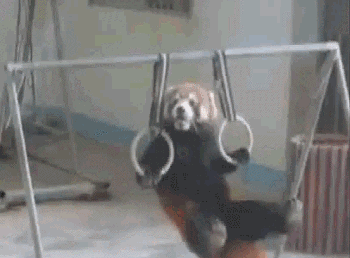Der Journalist Ralf Fischer hat bei den ruhrbaronen einen offenen Brief an ZAPP geschrieben. Darin kritisiert er den oben eingebundenen Film über die Vertrauenskrise der Medien, der in der letzten ZAPP-Sendung am 17.12.2014 ausgestrahlt wurde. Als Teil des Autorenteams antworte ich Ralf Fischer auf seine Kritik. Dies ist jedoch weder eine offizielle Antwort von Seiten des NDR, noch spreche ich im Namen meiner KollegInnen Sinje Stadtlich und Torben Börgers, die mit mir den Film gemacht haben. Es handelt sich hier um meine persönliche Meinung. (tldr am Ende des Textes.)
Worum geht’s?
- Fischer kritisiert kurz zusammengefasst, dass wir in unserem Beitrag „bundesweit bekannte Anhänger von Verschwörungstheorien und Antiamerikaner” zu Wort kommen ließen, ohne ihre Behauptungen zu widerlegen oder zu kritisieren. Somit sei unser Film nicht ausgewogen gewesen.
- Die Schuld an der Vertrauenskrise der großen Medien sieht er anscheinend ausschließlich bei den Konsumenten, die nicht mehr bereit wären für Journalismus zu bezahlen, was die Qualität beeinträchtigen würde.
- Die skeptische Stimmung gegen die „Mainstream-Medien” sei außerdem „ein antidemokratischer Reflex gegen die letzten Fundamente der vierte Gewalt”, dies hätten wir „denunzieren” sollen.
Ok, dann fangen wir mal an.
Lieber Herr Fischer,
wir kennen uns noch nicht, aber ich freue mich, dass Sie unseren Film gesehen haben und sich die Mühe gemacht haben, ihn so ausführlich kritisieren. Ich könnte ihnen jetzt genauso ausführlich antworten und jeden Punkt versuchen, zu entkräften.
Zum Beispiel, dass Herr Bröckers und Herr Wojnarowicz keinesfalls als „Kronzeugen” herangezogen wurde. Die Äußerung von Herrn Wojnarowicz diente lediglich dazu, das Stimmungsbild zu zeigen und Herr Bröckers kommt aus dramaturgischen Gründen mit _einem_ Satz zu Wort.
Denn was mich bei Bröckers interessierte, war nicht sein mit Paul Schreyer geschriebenes Buch, sondern die Menschen, die seine Meinung teilen: Dass DieMedien(tm) die WahrenHintergründe(tm) für den Ukraine-Konflikt verschweigen. Warum denken sie so etwas?

Matthias Bröckers bei der Lesung seines Buches „Wir sind die Guten. Ansichten eines Putin-Verstehers”. (Screenshot: NDR)
Auch der Vorwurf, in dem Film würden solche Theorien völlig unwidersprochen stehen gelassen, ist so nicht ganz richtig. Oder wie erklären Sie sich die O-Töne des Soziologen Andreas Anton, der erklärt, warum Verschwörungstheorien entstehen und welche Auswirkungen falsche Medienberichterstattung dabei haben kann? (Seinen Sammelband „Konspiration. Soziologie des Verschwörungsdenkens” kann ich dazu nur empfehlen.)

Andreas Anton forscht in Freiburg am Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene (IGPP). (Screenshot: NDR)
Doch eine dezidierte Auseinandersetzung mit ihren Kritikpunkten ist müßig, denn wir haben ein ganz anderes Problem: Sie haben einen anderen Film erwartet, als ich ihn mit meinen KollegInnen machen wollte.
Sie schreiben:
Ihnen gelingt es im Beitrag nicht, eine angemessene Kritik an der Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt mit einer Kritik an den verschwörungstheoretischen Montagsdemonstranten zu verknüpfen.
Statt darauf hinzuweisen, dass viele der geäußerten Vorwürfe völlig aus der Luft gegriffen sind, oder zumindest stark übertrieben, stellen sie diese Wortmeldungen als berechtigte Einwände dar. Ganz allgemein steht bei Ihnen die gesamte bundesdeutsche Presselandschaft als Angeklagter den Konsumenten als Unschuldslämmern gegenüber.
Das Missverständnis: Es war niemals die Absicht, die Montagsdemonstrationen oder die Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt zu kritisieren und das miteinander zu verknüpfen. Ich wollte etwas grundsätzlich Anderes:
Ich wollte wissen, wer diese Menschen sind, die sich im Netz so lautstark äußern, auf Demonstrationen gehen und wütende Kommentare und Mails an die Redaktionen schreiben. Was sie genau kritisieren, was sie antreibt, warum sie sagen, sie hätten keine Vertrauen mehr in die „Mainstream-Medien”. Ich wollte außerdem wie meine KollegInnen wissen, wie viele es sind und habe deswegen mit ihnen angeregt, eine Umfrage in Auftrag zu gegeben, was die Redaktion dann dankenswerterweise realisieren konnte (Ergebnisse, ausführliche Analyse und Interviews in voller Länge hier bei Zapp.)
Ich habe mir mit meinen Kollegen sehr lange überlegt, wie wir diesen Film machen. Wie man diesem schwer greifbarenpage Phänomen begegnen kann, es seziert, wie man es darstellen sollte. Ich habe dann mit ihnen eine Grundsatzentscheidung gefällt: Wir wollen nicht werten. Wir wollen uns auf keine Seite stellen. Wir wollen diesen Menschen mit Respekt begegnen und sie zu Wort kommen lassen, ihre Kritik hören und darstellen, ohne sie sofort zu dekonstruieren. Eine ur-journalistische Aufgabe, die sich gut mit Reportage-Elementen umsetzen lässt.
Mit „diesen Menschen” meine ich die Gesamtheit der Medienkritiker, einer sehr heterogenen Gruppe, die ich gedanklich sehr lange nicht in den Griff bekommen habe. Erst mit einem Schaubild wurde es halbwegs übersichtlich für mich:
Die Clusterung ist schwierig und nie eindeutig, viele Kritiker sind in Schnittmengen zu finden, aber es ist eine Methode, sich ihnen anzunähern und ein Portfolio der Kritik zu erstellen – genau das, was ich mit dem Film wollte.
Man kann die Argumente der drei Gruppen „Methoden-Kritiker”, „Haltungs-Kritiker” und „Verschwörungs-Kritiker” teilen oder nicht. Man kann sie auch kritisieren, ihnen widersprechen, wenn ihre Fakten falsch sind oder sie von anderen Prämissen ausgehen, die man nicht teilt. Aber man muss das nicht tun.
Man kann sie auch erst einmal anhören, wenn ihre Äußerungen vernünftig sind. Das gehört zu einer Medien-Demokratie, in der verschiedene Meinungen nebeneinander stehen dürfen und müssen. Eine anti-amerikanische Haltung ist nichts Verbotenes und es ist in meinen Augen auch Aufgabe von Medien, solchen Haltungen einen Platz zu geben, solange sie presserechtlich nicht angreifbar sind.
Aus diesem Grund kommen auch Verschwörungs-Kritiker nicht ausführlich zu Wort. Zum einen, um diese Menschen (mit denen wir gesprochen haben) zu schützen, aber auch, um genau das zu vermeiden, was Sie uns jetzt vorwerfen: Um sich nicht mit diesen Thesen gemein zu machen, die oft unbelegt oder sogar unbelegbar sind.
Deswegen finden Sie in dem Film keine einzige ausformulierte Theorie über von NATO, Weltjudentum und Reptilienmenschen gekauften Presse-Huren, die auf der anderen Seite des Monds mit Hitler satanische Feste feiern. Auch wenn Sie in Ihrem Brief so tun, als wäre das im Film der Fall.
Eines sollte man allerdings nicht tun: All diese Menschen in einen Topf werfen und ihre Meinungen „denunzieren”, wie sie es fordern.* Sie meinen damit zwar vor allem Personen wie Matthias Bröckers (über den wir uns übrigens sehr umfassend informiert haben), Marcel Wojnarowicz (genauso) oder Katrin McClean. Aber sie sprechen damit in meinen Augen ein Generalurteil über alle, die Medienkritik äußern.
Ich sehe in der Grundsatzentscheidung, Kritiker ernst zu nehmen, Parallelen zu einem anderen Medien-Phänomen, das gerade herumspukt und an dem sich fast alle großen Medien mehrfach abgearbeitet haben. Die tausende Pegida-Demonstranten irritieren einen Großteil des mittelständischen Bürgertums (auch mich), aber sie als Nazi-Idioten zu bashen halte ich für grundsätzlich falsch.*
Denn auch, wenn dort tausende Menschen auf der Straße stehen und hanebüchene Argumente bringen, so steht dahinter doch etwas sehr schwer Angreifbares, was sich nicht wegdiskutieren lässt: Ein Gefühl. Ein Gefühl ist das finale Argument, denn ein Gefühl kann man einem Menschen nicht absprechen oder verbieten.
Wenn Menschen sich vom Islam bedroht, von Politikern nicht ernst genommen und von Medien belogen fühlen, so halte ich es für fatal ihnen zu sagen: Das dürft ihr nicht. Das ist Unsinn. Ihr spinnt.
Denn so fühlen sie sich am Ende bestätigt, ausgeschlossen, diffamiert und es passiert das, was Vanessa Edmeier am Ende des Films befürchtet: Sie rennen den falschen Leuten in die Hände, weil diese einfache Antworten auf komplexe Fragen bieten.

Vanessa Edmeier, Studentin. Sie fühlt sich mit Ihrer Medienkritik oft nicht ernst genommen.
Aus diesem Grund war es für mich sehr wichtig, mit einem so breiten Spektrum wie möglich zu reden. Mit Menschen, die das Mediensystem und seine Methoden kritisieren wie Matthias Drescher. Mit Menschen, die ihre eigene politische Haltung nicht in den großen Medien wiederfinden, wie Katrin McClean. Oder mit Menschen, die an die Medien glauben, aber sich mit ihrer Kritik nicht gehört fühlen, wie Vanessa Edmeier.
Denn an fast allen Kritikpunkten ist irgendwo etwas dran. Sie sind nicht grundsätzlich falsch. Medien haben in der Vergangenheit Fehler gemacht, werden sie immer machen, denn sie werden von Menschen gemacht und die sind nicht fehlerfrei. Es ist mir aber wichtig, diese Fehler zu benennen, es ist mir wichtig, sich und das journalistische System immer wieder in Frage zu stellen. Erst Recht, wenn einem die Kritik so geballt entgegen kommt wie dieses Jahr.
Spätestens dann sollte man sich fragen: Warum ist das so? Ist die Kritik berechtigt? Und was muss man eventuell ändern?
Sie schreiben dazu:
Wenn die Konsumenten nicht mehr ihren Beitrag zur Finanzierung eines unabhängigen Journalismus leisten, stattdessen als Informationsquellen staatlich gelenkte Medienkonzerne (Russia Today, Al Jazeera) nutzen, dann ist es nur logisch, dass die journalistische Qualität darunter leidet.
Ebenso sind die Konsumenten darauf hinzuweisen, dass die Jagd nach der neuesten Meldung, die rasante Geschwindigkeit bei der Veröffentlichung, ihrem Nutzerverhalten geschuldet ist. Jeder Journalist hätte gern mehr Zeit für Recherche, doch bekommt er sie letztendlich vom Konsumenten nicht bezahlt.
Die „Schuld” liegt also in Ihren Augen ausschließlich bei den Konsumenten, die nicht mehr zu zahlen bereit sind, weshalb Journalisten gezwungen sind, unsauber zu arbeiten. Entschuldigen Sie, aber das ist mir zu eindimensional. Es gibt sehr viele Gründe für die generelle Medienkrise, Sie nennen einen davon, aber das ist längst nicht der Einzige.
Die ökonomische Krise der Journalismus hat auch seine Ursachen bei Verlagen, die nicht auf ihre 20% Rendite verzichten wollen. Bei Werbekunden, die signifikant weniger Geld zahlen als in den „alten” Medien. Sie liegt auch an der Struktur des Internets, welches den beschränkten Zugang zu Informationen, die man verkaufen konnte, aufgehoben hat.
Die Vertrauenskrise mag von dieser ökologischen Krise mit ausgelöst worden sein, aber auch das ist nur _ein_ Grund. Das Vertrauen wurde auch untergraben von eben dieser ungefilterten Internetstruktur, die eine Informationsflut ausgelöst hat.
Sie fließen seitdem ungehindert an den alten Informationswächtern in den Redaktionen vorbei und werfen neue Fragen auf: Warum ist eine Information auf der einen Seite enthalten, aber nicht auf der anderen? Warum wurde diese Nachricht ausgewählt und nicht jene? Warum stellt diese Seite die Welt ganz anders dar als die andere?
Hinzu kommen soziale Netzwerke, die eine Vernetzung von Gleichgesinnten so einfach machen wie noch nie zuvor. Sie können sich gegenseitig informieren, aber auch anstacheln, hochjazzen, aufpeitschen und sich in ihrer Weltsicht bestätigen.
Auf alle diese Disruptionen haben sich große Teile des Journalismus noch nicht angepasst. Stattdessen halten sich viele an journalistischen Riten fest, in der Hoffnung, dass die auch die nächsten 50 Jahre noch funktionieren.
Auch dadurch wurde diese journalistische Vertrauenskrise mit ausgelöst. Durch eine arrogante „Wir sind Journalisten, wir sind die vierte Gewalt, Respektiert meine Autorität”-Haltung. Durch Kritikunfähigkeit. Durch mangelnden Dialog. Durch Vorverurteilung.
Durch solche Äußerungen:
Die allgemeine Stimmung gegenüber der „Lügenpresse“ bzw. den „Systemmedien“ ist ein antidemokratischer Reflex gegen die letzten Fundamente der vierte Gewalt. Dies gilt es in einem kritischen Medienmagazin zu denunzieren.
Nein, Herr Fischer. Denunzieren ist nicht die Aufgabe von Journalisten. Sondern darstellen, vermitteln, moderieren, aufdecken und bei der Meinungsbildung helfen. Auch mit Kritik. Aber nicht nur.
Mit besten Grüßen und Wünschen für das neue Jahr,
Daniel Bröckerhoff
Wenn Du bis hierhin gelesen hast: Vielen Dank! Zur Belohnung gibt es ein Lied über Kartoffeln.
*Ausnahme: In Rants, Satire und anderen Kunstformen ist das in meinen Augen etwas anderes. Deswegen konnte ich Ken Jebsen auch als „Vollhupe” bezeichnen.